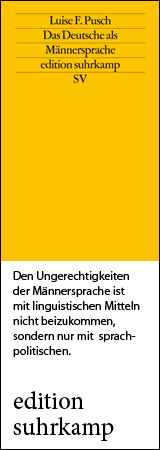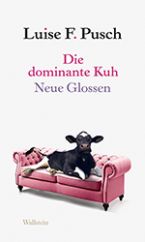geboren am 17. April 1940 in Nantes
gestorben am 11. Februar 2020 in Paris
französische Zeichnerin und Autorin
5. Todestag am 11. Februar 2025
85. Geburtstag am 17. April 2025
Biografie • Zitate • Weblinks • Literatur & Quellen
Biografie
Blasierte 40Jährige, die auf Partys über die Weltrevolution schwadronieren; genervte Teenager mit Angst vor Orangenhaut; emanzipierte Frauen, die ihre Männer in die Wüste schicken, dann aber zum Öffnen der Weinflasche doch wieder brauchen – sie alle bekommen bei Claire Bretécher ihr Fett weg. Mit spitzem Stift und spitzer Zunge karikierte sie die Menschen ihrer Umgebung in all ihren Widersprüchen - die urbane Pariser Elite, die 68er, die Feministinnen, aber auch ganz „normale“ Frauen im täglichen Geschlechterkampf. Ihre Darstellungen waren bissig, aber nie gemein, und immer mit einer gehörigen Portion (Selbst)ironie serviert. Und die Dargestellten genossen es offensichtlich, so vorgeführt zu werden. Claire Bretéchers Gagserien Salades de saison (dt. Kopfsalat, 1978) und Les Frustrés (dt. Die Frustrierten, 1978-1980) erreichten in den 1970er und 80er Jahren in Frankreich Kultstatus. Als erste Frau konnte sie sich in der stark männerlastigen Comicszene durchsetzen. Ihre insgesamt 30 Alben erzielten astronomische Auflagen und wurden in viele Sprachen übersetzt. Schon früh entschied sie sich, ihre Alben im Eigenverlag herauszubringen, um nicht von einem Verleger abhängig zu sein. So war sie Zeichnerin, Autorin und Publizistin in einer Person – auch darin eine Pionierin.
Claire Bretécher wuchs in Nantes in einer gutbürgerlichen, katholischen Familie auf, die sie nach Abschluss der Schule so schnell wie möglich hinter sich lassen wollte. Nach einem kurzen Kunststudium zog sie 1960 als 20Jährige, „ziemlich verwöhnt und immer pleite“ nach Paris, wohnte in vergammelten Altbauzimmern in Montmartre und begriff erst langsam, dass man eine Arbeit braucht, um Miete und Essen bezahlen zu können. Sie jobbte als Zeichenlehrerin, Babysitterin, verkaufte Zeichnungen an katholische Kinder- und Jugendzeitschriften, die den Vorteil hatten, schnell und zuverlässig zu zahlen. Eine erste Zusammenarbeit mit René Goscinny, dem berühmten Asterix-Erfinder, endete im Desaster. Goscinny fand ihre Arbeit nicht gut genug (sie selber auch nicht). Einige Jahre später kam sie wieder, dieses Mal mit einer kompletten Geschichte über eine äußerst ungraziöse, meistens mürrische Prinzessin mit dem bezeichnenden Namen Cellulite, 1972 (dt. Zellulitis, 1984), die schwankt zwischen ihrer Sehnsucht nach dem Märchenprinzen und ihren Unabhängigkeitsbestrebungen. Der Zeitpunkt war günstig – die bande dessinée (Comic strip), bis dahin v.a. geprägt von Abenteuer- und Cowboygeschichten für Jungs, hatte begonnen, sich zu einer ernst genommenen Erwachsenenliteratur zu entwickeln. Bretéchers Cartoons mit ihren scheinbar locker aufs Papier geworfenen Alltagsszenen, vieldeutigen Dialogfetzen und – endlich – zumeist weiblichen Figuren kamen genau richtig.
Drei Jahre arbeitete sie, allein unter Männern, im Redaktionskomitee von Goscinnys Zeitschrift Pilote, dann gründete sie mit zwei Kollegen eine eigene Zeitschrift, L’Echo des Savanes („nur für Erwachsene in Begleitung ihrer Eltern“). 1973 kam ihr Durchbruch beim breiten Publikum. Jean Daniel, Chefredakteur des Nouvel Observateur, der wichtigsten linken französischen Wochenzeitschrift, bat sie um einen regelmäßigen Beitrag. „Machen Sie sich über uns lustig“, lautete sein Auftrag. Dies war der Auftakt für die Frustrierten, gefolgt von zahlreichen anderen, ebenso erfolgreichen Serien, in denen es um alles ging: Geschlechterkonflikte, Sexualität, Verhütung und Abtreibung, unerfüllte Kinderwünsche und antiautoritäre Erziehung, Schönheitsoperationen, Patchworkfamilien, Massentourismus. 35 Jahre lang lieferte Claire Bretécher fast jede Woche eine Seite und um die 20 Titelbilder für den Nouvel Obs, obwohl sie, wie sie sagte, „mit Politik nichts am Hut hatte“. Aber sie besaß, neben ihrem großartigen zeichnerischen Talent, ein untrügliches Gespür für gesellschaftliche Konfliktfelder und war ihrer Zeit dabei oft voraus. So erschien schon 1983, als noch kaum jemand von In-Vitro-Fertilisation gehört hatte, ihre Serie Le destin de Monique (dt. Monika, das Wunschkind, 1985) über die verrückte und komisch- verzweifelte Suche einer Karrierefrau nach einer Leihmutter. Einige Jahre später, inzwischen hatte sie den Juristen Guy Carcassonne geheiratet und ihren Sohn Martin zur Welt gebracht, erfand Bretécher ihre beliebteste Antiheldin, Agrippine, 1988 (dt. Agrippina, 1994), eine egozentrische Jugendliche im bauchfreien Top und Schlabberhosen, die beständig im Clinch mit ihren Spät68er-Eltern liegt. Agrippines Selbstfindungskonflikte füllten im Laufe der Jahre insgesamt neun Alben, das letzte erschienen 2009, und wurden in 26 Episoden fürs Fernsehen adaptiert.
2013, Bretécher war 73, als ihr Mann auf einer Reise in St. Petersburg ganz plötzlich an einer Hirnblutung starb, ein Schock, von dem sie sich nur schwer erholte. 2015 zeigte das Pariser Centre Pompidou eine große Retrospektivausstellung mit Hunderten von Originalen ihrer Cartoons und einer Auswahl ihrer „privaten Porträts“, Gemälden von Familienmitgliedern und FreundIinnen, die sie bis dahin nie öffentlich ausgestellt hatte. Im Folgejahr wurde sie als erste Frau beim Internationalen Comic-Salon in Erlangen mit dem Max-und-Moritz-Preis für ihr „herausragendes Lebenswerk“ geehrt, ein kleiner Trost vielleicht dafür, dass sie den ihr natürlich zustehenden renommierten französischen „Comic-Oscar“ beim Festival von Angoulême nie bekommen hatte. 1982 hatten sich dort die Jury-Männer für sie einen etwas merkwürdigen „Sonderpreis“ zum 10jährigen Bestehen des Festivals ausgedacht, erst im Jahr 2000 erhielt mit Florence Cestac zum ersten Mal eine Frau den Hauptpreis.
Eigentlich wollte Bretécher im Alter wie Zonzon werden, Agrippines unangepasste Urgroßmutter mit Hang zum Graffitti-Sprayen. Das war ihr nicht vergönnt. Sie starb 2020, erst 79 Jahre alt, nachdem sie einige Jahre zuvor an Alzheimer erkrankt war.
(Text von 2024)
Verfasserin: Andrea Schweers
Zitate
Je suis égoiste, donc je suis féministe.
(frei übersetzt : Ich bin schon deshalb Feministin, weil ich egoistisch bin).
Was soll das heißen: „Jahr der Frau“? Am 31. Dezember sollen wir uns dann wieder kleinmachen? Wieder zurück in die Küche? (1975)
Ich bin nicht sehr begabt, ich will mich nur amüsieren. (2015)
Links
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/claire-bretecher-en-1975-je-suis-une-feministe-engagee-mais-pas-militante (Interview Claire Brétecher zum Feminismus), 1975
https://www.youtube.com/watch?v=uAoi6y74vKs („ Les yeux de Claire Brétecher“, Gespräch mit Guy de Belleval über ihre Kindheit, 1977)
https://www.tcj.com/madame-audacity-the-art-of-claire-bretecher/ (Ausstellung Claire Brétecher im Centre Pompidou, November 2015)
https://www.francetvinfo.fr/culture/bd/bretecher-a-beaubourg-indemodable_3334817.html (Ausstellung Brétecher, Centre Pompidou)
https://www.tagesspiegel.de/kultur/comics/die-max-und-moritz-preistrager-2016-3727006.html (Laudatio Sonderpreis für ein herausragendes Lebenswerk: Claire Brétecher, 29.5.2016)
Literatur & Quellen
Boy, Florie. 2009. Les femmes dans la bande dessinée d’auteur depuis les années 1970. Itinéraires croisés : Claire Brétecher, Chantal Montellier, Marjane Satrapi. Diplôme national de Master.
Daniel, Jean. 2020. Bretécher: Le destin de Claire. Dossier du Nouvel Observateur, Paris.
Sollten Sie RechteinhaberIn eines Bildes und mit der Verwendung auf dieser Seite nicht einverstanden sein, setzen Sie sich bitte mit Fembio in Verbindung.